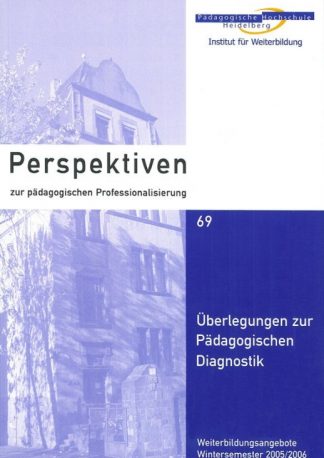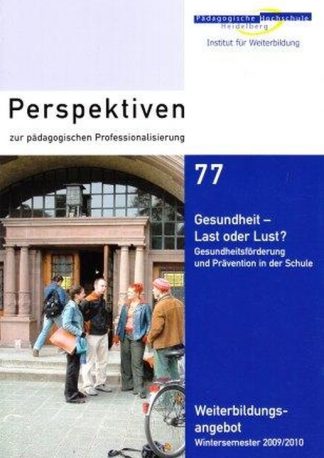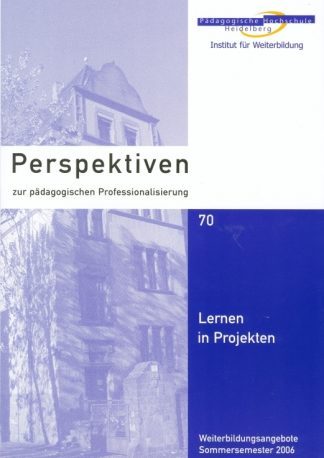Inhalt
Im Grundlagenartikel von Marold Wosnitza und Balthasar Eugster zeigen die beiden Autoren die Verwebung von Schul- und Lebenshandeln auf, mit dem lerntheoretischen Blick, dass das Lernen in Projekten für beides eine Bedeutung hat.
Nach Carl-Peter Buschkühle kommen der Kunst im schulischen Kontext verschiedene Bedeutungen zu, die in radikalem Gegensatz zu einem falsch verstandenen und praktizierten Kunstunterricht und seinen Kürzungen im Gefüge der Stundentafel stehen. Er stellt dabei verschiedene Aspekte des künstlerischen Denkens und Handelns in den Mittelpunkt, von denen er dann Elemente der Dekonstruktion ableitet, die künstlerisches Denken fördern.
Im Beitrag von Veronika Strittmatter-Haubold und Annelie Wellensieck geht es um die reflexive Lehrerbildung, die vor allem durch die Form von Projektseminaren gefördert werden kann. In ihrem Beitrag stellen sie zwei Seminare gegenüber.
Frontalunterricht möchten Dörthe Krause und Peter Eyerer gerne durch die kombinierte Lehr-Lern-Methode, der TheoPrax-Methodik, die seit knapp 10 Jahren für Schule und Hochschule entwickelt und permanent weiterentwickelt wurde, ablösen oder doch zumindestens bereichern. Projekte mit Ernstcharakter stellen für sie den Königsweg zu einem motivierenden Lernen dar, der vor allem auch die aktive Wissensbeschaffung als Kernkompetenz erfolgt.
In einem Bericht über das Lernen in ergebnisoffenen Projekten mit „Ernstcharakter“ reflektiert Ulrike Ohl ihre Erfahrungen als Dozentin mit Gruppen von Studierenden in der Geographie-Didaktik. Ebenso verdeutlicht sie die Chancen, aber auch die Schwierigkeiten und Grenzen dieser Methode.
Am Ende des Themenheftes befindet sich ein Erfahrungsbericht aus einem Projektseminar im Fach Französisch. Studierende schreiben über ihre Erfahrungen und einzelnen Etappen, die sie während ihres Projektes durchlaufen haben, welche Lernchancen sie hatten und wie sie die Methode einschätzen.